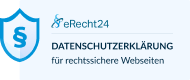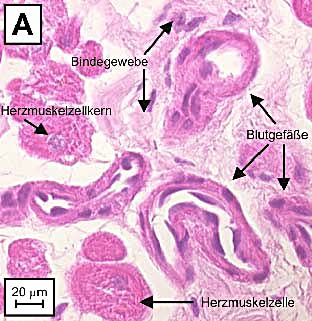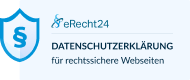1. Datenschutz auf einen Blick
Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie diese Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.
Datenerfassung auf dieser Website
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Abschnitt „Hinweis zur Verantwortlichen Stelle“ in dieser Datenschutzerklärung entnehmen.
Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z. B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.
Andere Daten werden automatisch oder nach Ihrer Einwilligung beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z. B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie diese Website betreten.
Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden. Sofern über die Website Verträge geschlossen oder angebahnt werden können, werden die übermittelten Daten auch für Vertragsangebote, Bestellungen oder sonstige Auftragsanfragen verarbeitet.
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Wenn Sie eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern
Beim Besuch dieser Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor allem mit sogenannten Analyseprogrammen.
Detaillierte Informationen zu diesen Analyseprogrammen finden Sie in der folgenden Datenschutzerklärung.
2. Hosting
Wir hosten die Inhalte unserer Website bei folgendem Anbieter:
Externes Hosting
Diese Website wird extern gehostet. Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters / der Hoster gespeichert. Hierbei kann es sich v. a. um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten, Namen, Websitezugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden, handeln.
Das externe Hosting erfolgt zum Zwecke der Vertragserfüllung gegenüber unseren potenziellen und bestehenden Kunden (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und im Interesse einer sicheren, schnellen und effizienten Bereitstellung unseres Online-Angebots durch einen professionellen Anbieter (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TDDDG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Unser(e) Hoster wird bzw. werden Ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erfüllung seiner Leistungspflichten erforderlich ist und unsere Weisungen in Bezug auf diese Daten befolgen.
Wir setzen folgende(n) Hoster ein:
Serverprofis GmbH
Mondstr. 2-4
D-85622 Feldkirchen
Auftragsverarbeitung
Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) zur Nutzung des oben genannten Dienstes geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.
3. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
transplantiert e.V.
Zescher Straße 12
12307 Berlin
Telefon: (0 30) 76 40 45 93
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z. B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.
Speicherdauer
Soweit innerhalb dieser Datenschutzerklärung keine speziellere Speicherdauer genannt wurde, verbleiben Ihre personenbezogenen Daten bei uns, bis der Zweck für die Datenverarbeitung entfällt. Wenn Sie ein berechtigtes Löschersuchen geltend machen oder eine Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen, werden Ihre Daten gelöscht, sofern wir keine anderen rechtlich zulässigen Gründe für die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten haben (z. B. steuer- oder handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen); im letztgenannten Fall erfolgt die Löschung nach Fortfall dieser Gründe.
Allgemeine Hinweise zu den Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung auf dieser Website
Sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO, sofern besondere Datenkategorien nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO verarbeitet werden. Im Falle einer ausdrücklichen Einwilligung in die Übertragung personenbezogener Daten in Drittstaaten erfolgt die Datenverarbeitung außerdem auf Grundlage von Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sofern Sie in die Speicherung von Cookies oder in den Zugriff auf Informationen in Ihr Endgerät (z. B. via Device-Fingerprinting) eingewilligt haben, erfolgt die Datenverarbeitung zusätzlich auf Grundlage von § 25 Abs. 1 TDDDG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Sind Ihre Daten zur Vertragserfüllung oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Des Weiteren verarbeiten wir Ihre Daten, sofern diese zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich sind auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Die Datenverarbeitung kann ferner auf Grundlage unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgen. Über die jeweils im Einzelfall einschlägigen Rechtsgrundlagen wird in den folgenden Absätzen dieser Datenschutzerklärung informiert.
Empfänger von personenbezogenen Daten
Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit arbeiten wir mit verschiedenen externen Stellen zusammen. Dabei ist teilweise auch eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an diese externen Stellen erforderlich. Wir geben personenbezogene Daten nur dann an externe Stellen weiter, wenn dies im Rahmen einer Vertragserfüllung erforderlich ist, wenn wir gesetzlich hierzu verpflichtet sind (z. B. Weitergabe von Daten an Steuerbehörden), wenn wir ein berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO an der Weitergabe haben oder wenn eine sonstige Rechtsgrundlage die Datenweitergabe erlaubt. Beim Einsatz von Auftragsverarbeitern geben wir personenbezogene Daten unserer Kunden nur auf Grundlage eines gültigen Vertrags über Auftragsverarbeitung weiter. Im Falle einer gemeinsamen Verarbeitung wird ein Vertrag über gemeinsame Verarbeitung geschlossen.
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)
WENN DIE DATENVERARBEITUNG AUF GRUNDLAGE VON ART. 6 ABS. 1 LIT. E ODER F DSGVO ERFOLGT, HABEN SIE JEDERZEIT DAS RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN WIDERSPRUCH EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR EIN AUF DIESE BESTIMMUNGEN GESTÜTZTES PROFILING. DIE JEWEILIGE RECHTSGRUNDLAGE, AUF DENEN EINE VERARBEITUNG BERUHT, ENTNEHMEN SIE DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG. WENN SIE WIDERSPRUCH EINLEGEN, WERDEN WIR IHRE BETROFFENEN PERSONENBEZOGENEN DATEN NICHT MEHR VERARBEITEN, ES SEI DENN, WIR KÖNNEN ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN, DIE IHRE INTERESSEN, RECHTE UND FREIHEITEN ÜBERWIEGEN ODER DIE VERARBEITUNG DIENT DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 1 DSGVO).
WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, SO HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR DAS PROFILING, SOWEIT ES MIT SOLCHER DIREKTWERBUNG IN VERBINDUNG STEHT. WENN SIE WIDERSPRECHEN, WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ANSCHLIESSEND NICHT MEHR ZUM ZWECKE DER DIREKTWERBUNG VERWENDET (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 2 DSGVO).
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.
Auskunft, Berichtigung und Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Hierzu können Sie sich jederzeit an uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:
- Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, benötigen wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
- Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah/geschieht, können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.
- Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
- Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
Widerspruch gegen Werbe-E-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.
4. Datenerfassung auf dieser Website
Cookies
Unsere Internetseiten verwenden so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Datenpakete und richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an. Sie werden entweder vorübergehend für die Dauer einer Sitzung (Session-Cookies) oder dauerhaft (permanente Cookies) auf Ihrem Endgerät gespeichert. Session-Cookies werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Permanente Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese selbst löschen oder eine automatische Löschung durch Ihren Webbrowser erfolgt.
Cookies können von uns (First-Party-Cookies) oder von Drittunternehmen stammen (sog. Third-Party-Cookies). Third-Party-Cookies ermöglichen die Einbindung bestimmter Dienstleistungen von Drittunternehmen innerhalb von Webseiten (z. B. Cookies zur Abwicklung von Zahlungsdienstleistungen).
Cookies haben verschiedene Funktionen. Zahlreiche Cookies sind technisch notwendig, da bestimmte Webseitenfunktionen ohne diese nicht funktionieren würden (z. B. die Warenkorbfunktion oder die Anzeige von Videos). Andere Cookies können zur Auswertung des Nutzerverhaltens oder zu Werbezwecken verwendet werden.
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs, zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z. B. für die Warenkorbfunktion) oder zur Optimierung der Website (z. B. Cookies zur Messung des Webpublikums) erforderlich sind (notwendige Cookies), werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert, sofern keine andere Rechtsgrundlage angegeben wird. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von notwendigen Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Sofern eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies und vergleichbaren Wiedererkennungstechnologien abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage dieser Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG); die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
Welche Cookies und Dienste auf dieser Website eingesetzt werden, können Sie dieser Datenschutzerklärung entnehmen.
Einwilligung mit Usercentrics
Diese Website nutzt die Consent-Technologie von Usercentrics, um Ihre Einwilligung zur Speicherung bestimmter Cookies auf Ihrem Endgerät oder zum Einsatz bestimmter Technologien einzuholen und diese datenschutzkonform zu dokumentieren. Anbieter dieser Technologie ist die Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Website: https://usercentrics.com/de/ (im Folgenden „Usercentrics“).
Wenn Sie unsere Website betreten, werden folgende personenbezogene Daten an Usercentrics übertragen:
- Ihre Einwilligung(en) bzw. der Widerruf Ihrer Einwilligung(en)
- Ihre IP-Adresse
- Informationen über Ihren Browser
- Informationen über Ihr Endgerät
- Zeitpunkt Ihres Besuchs auf der Website
- Geolocation
Des Weiteren speichert Usercentrics ein Cookie in Ihrem Browser, um Ihnen die erteilten Einwilligungen bzw. deren Widerruf zuordnen zu können. Die so erfassten Daten werden gespeichert, bis Sie uns zur Löschung auffordern, das Usercentrics-Cookie selbst löschen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.
Das Usercentrics-Banner auf dieser Website wurde mit Hilfe von eRecht24 konfiguriert. Das erkennen Sie daran, dass im Banner das Logo von eRecht24 auftaucht. Um das eRecht24-Logo im Banner auszuspielen, wird eine Verbindung zum Bildserver von eRecht24 hergestellt. Hierbei wird auch die IP-Adresse übertragen, die jedoch nur in anonymisierter Form in den Server-Logs gespeichert wird. Der Bildserver von eRecht24 befindet sich in Deutschland bei einem deutschen Anbieter. Das Banner selbst wird ausschließlich von Usercentrics zur Verfügung gestellt.
Der Einsatz von Usercentrics erfolgt, um die gesetzlich vorgeschriebenen Einwilligungen für den Einsatz bestimmter Technologien einzuholen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.
Auftragsverarbeitung
Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) zur Nutzung des oben genannten Dienstes geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.
Server-Log-Dateien
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
- Browsertyp und Browserversion
- verwendetes Betriebssystem
- Referrer URL
- Hostname des zugreifenden Rechners
- Uhrzeit der Serveranfrage
- IP-Adresse
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der Optimierung seiner Website – hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden.
Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) sofern diese abgefragt wurde; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.
Anfrage per E-Mail, Telefon oder Telefax
Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon oder Telefax kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller daraus hervorgehenden personenbezogenen Daten (Name, Anfrage) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) sofern diese abgefragt wurde; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.
5. Soziale Medien
Instagram
Auf dieser Website sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irland.
Wenn das Social-Media-Element aktiv ist, wird eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Endgerät und dem Instagram-Server hergestellt. Instagram erhält dadurch Informationen über den Besuch dieser Website durch Sie.
Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt sind, können Sie durch Anklicken des Instagram-Buttons die Inhalte dieser Website mit Ihrem Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch dieser Website Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten.
Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Soweit mit Hilfe des hier beschriebenen Tools personenbezogene Daten auf unserer Website erfasst und an Facebook bzw. Instagram weitergeleitet werden, sind wir und die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemeinsam für diese Datenverarbeitung verantwortlich (Art. 26 DSGVO). Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf die Erfassung der Daten und deren Weitergabe an Facebook bzw. Instagram. Die nach der Weiterleitung erfolgende Verarbeitung durch Facebook bzw. Instagram ist nicht Teil der gemeinsamen Verantwortung. Die uns gemeinsam obliegenden Verpflichtungen wurden in einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung festgehalten. Den Wortlaut der Vereinbarung finden Sie unter: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Laut dieser Vereinbarung sind wir für die Erteilung der Datenschutzinformationen beim Einsatz des Facebook- bzw. Instagram-Tools und für die datenschutzrechtlich sichere Implementierung des Tools auf unserer Website verantwortlich. Für die Datensicherheit der Facebook bzw. Instagram-Produkte ist Facebook verantwortlich. Betroffenenrechte (z. B. Auskunftsersuchen) hinsichtlich der bei Facebook bzw. Instagram verarbeiteten Daten können Sie direkt bei Facebook geltend machen. Wenn Sie die Betroffenenrechte bei uns geltend machen, sind wir verpflichtet, diese an Facebook weiterzuleiten.
Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/.
Das Unternehmen verfügt über eine Zertifizierung nach dem „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). Der DPF ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, der die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards bei Datenverarbeitungen in den USA gewährleisten soll. Jedes nach dem DPF zertifizierte Unternehmen verpflichtet sich, diese Datenschutzstandards einzuhalten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Anbieter unter folgendem Link: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/4452.
6. Analyse-Tools und Werbung
Matomo
Diese Website benutzt den Open Source Webanalysedienst Matomo.
Mit Hilfe von Matomo sind wir in der Lage Daten über die Nutzung unserer Website durch die Websitebesucher zu erfassen und zu analysieren. Hierdurch können wir u. a. herausfinden, wann welche Seitenaufrufe getätigt wurden und aus welcher Region sie kommen. Außerdem erfassen wir verschiedene Logdateien (z. B. IP-Adresse, Referrer, verwendete Browser und Betriebssysteme) und können messen, ob unsere Websitebesucher bestimmte Aktionen durchführen (z. B. Klicks, Käufe u. Ä.).
Die Nutzung dieses Analyse-Tools erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TDDDG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
IP-Anonymisierung
Bei der Analyse mit Matomo setzen wir IP-Anonymisierung ein. Hierbei wird Ihre IP-Adresse vor der Analyse gekürzt, sodass Sie Ihnen nicht mehr eindeutig zuordenbar ist.
Cookielose Analyse
Wir haben Matomo so konfiguriert, dass Matomo keine Cookies in Ihrem Browser speichert.
Hosting
Wir hosten Matomo bei folgendem Drittanbieter:
Serverprofis GmbH
Mondstr. 2-4
D-85622 Feldkirchen
Auftragsverarbeitung
Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) zur Nutzung des oben genannten Dienstes geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.
7. Newsletter
Newsletterdaten
Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben diese nicht an Dritte weiter.
Die Verarbeitung der in das Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den „Austragen“-Link im Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters oder nach Zweckfortfall aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Wir behalten uns vor, E-Mail-Adressen aus unserem Newsletterverteiler nach eigenem Ermessen im Rahmen unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zu löschen oder zu sperren.
Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden, bleiben hiervon unberührt.
Nach Ihrer Austragung aus der Newsletterverteilerliste wird Ihre E-Mail-Adresse bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter ggf. in einer Blacklist gespeichert, sofern dies zur Verhinderung künftiger Mailings erforderlich ist. Die Daten aus der Blacklist werden nur für diesen Zweck verwendet und nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Dies dient sowohl Ihrem Interesse als auch unserem Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern (berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Sie können der Speicherung widersprechen, sofern Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse überwiegen.
8. Plugins und Tools
YouTube mit erweitertem Datenschutz
Diese Website bindet Videos der Website YouTube ein. Betreiber der Website ist die Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Wenn Sie eine dieser Website besuchen, auf denen YouTube eingebunden ist, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.
Wir nutzen YouTube im erweiterten Datenschutzmodus. Videos, die im erweiterten Datenschutzmodus abgespielt werden, werden nach Aussage von YouTube nicht zur Personalisierung des Surfens auf YouTube eingesetzt. Anzeigen, die im erweiterten Datenschutzmodus ausgespielt werden, sind ebenfalls nicht personalisiert. Im erweiterten Datenschutzmodus werden keine Cookies gesetzt. Stattdessen werden jedoch sogenannte Local Storage Elemente im Browser des Users gespeichert, die ähnlich wie Cookies personenbezogene Daten beinhalten und zur Wiedererkennung eingesetzt werden können. Details zum erweiterten Datenschutzmodus finden Sie hier: https://support.google.com/youtube/answer/171780.
Gegebenenfalls können nach der Aktivierung eines YouTube-Videos weitere Datenverarbeitungsvorgänge ausgelöst werden, auf die wir keinen Einfluss haben.
Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TDDDG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube finden Sie in deren Datenschutzerklärung unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Das Unternehmen verfügt über eine Zertifizierung nach dem „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). Der DPF ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, der die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards bei Datenverarbeitungen in den USA gewährleisten soll. Jedes nach dem DPF zertifizierte Unternehmen verpflichtet sich, diese Datenschutzstandards einzuhalten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Anbieter unter folgendem Link: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/5780.
Vimeo ohne Tracking (Do-Not-Track)
Diese Website nutzt Plugins des Videoportals Vimeo. Anbieter ist die Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Wenn Sie eine unserer mit Vimeo-Videos ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von Vimeo hergestellt. Dabei wird dem Vimeo-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Zudem erlangt Vimeo Ihre IP-Adresse. Wir haben Vimeo jedoch so eingestellt, dass Vimeo Ihre Nutzeraktivitäten nicht nachverfolgen und keine Cookies setzen wird.
Die Nutzung von Vimeo erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission sowie nach Aussage von Vimeo auf „berechtigte Geschäftsinteressen“ gestützt. Details finden Sie hier: https://vimeo.com/privacy.
Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Vimeo unter: https://vimeo.com/privacy.
Das Unternehmen verfügt über eine Zertifizierung nach dem „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). Der DPF ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, der die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards bei Datenverarbeitungen in den USA gewährleisten soll. Jedes nach dem DPF zertifizierte Unternehmen verpflichtet sich, diese Datenschutzstandards einzuhalten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Anbieter unter folgendem Link: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/5711.
Google Fonts (lokales Hosting)
Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Google Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Die Google Fonts sind lokal installiert. Eine Verbindung zu Servern von Google findet dabei nicht statt.
Weitere Informationen zu Google Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Google reCAPTCHA
Wir nutzen „Google reCAPTCHA“ (im Folgenden „reCAPTCHA“) auf dieser Website. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Mit reCAPTCHA soll überprüft werden, ob die Dateneingabe auf dieser Website (z. B. in einem Kontaktformular) durch einen Menschen oder durch ein automatisiertes Programm erfolgt. Hierzu analysiert reCAPTCHA das Verhalten des Websitebesuchers anhand verschiedener Merkmale. Diese Analyse beginnt automatisch, sobald der Websitebesucher die Website betritt. Zur Analyse wertet reCAPTCHA verschiedene Informationen aus (z. B. IP-Adresse, Verweildauer des Websitebesuchers auf der Website oder vom Nutzer getätigte Mausbewegungen). Die bei der Analyse erfassten Daten werden an Google weitergeleitet.
Die reCAPTCHA-Analysen laufen vollständig im Hintergrund. Websitebesucher werden nicht darauf hingewiesen, dass eine Analyse stattfindet.
Die Speicherung und Analyse der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse daran, seine Webangebote vor missbräuchlicher automatisierter Ausspähung und vor SPAM zu schützen. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TDDDG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA entnehmen Sie den Google-Datenschutzbestimmungen und den Google Nutzungsbedingungen unter folgenden Links: https://policies.google.com/privacy?hl=de und https://policies.google.com/terms?hl=de.
Das Unternehmen verfügt über eine Zertifizierung nach dem „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). Der DPF ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, der die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards bei Datenverarbeitungen in den USA gewährleisten soll. Jedes nach dem DPF zertifizierte Unternehmen verpflichtet sich, diese Datenschutzstandards einzuhalten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Anbieter unter folgendem Link: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/5780.
9. eCommerce und Zahlungsanbieter
Verarbeiten von Kunden- und Vertragsdaten
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Kunden- und Vertragsdaten zur Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung und Änderung unserer Vertragsbeziehungen. Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme dieser Website (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der Geschäftsbeziehung und Ablauf der ggf. bestehenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.
10. Audio- und Videokonferenzen
Datenverarbeitung
Für die Kommunikation mit unseren Kunden setzen wir unter anderen Online-Konferenz-Tools ein. Die im Einzelnen von uns genutzten Tools sind unten aufgelistet. Wenn Sie mit uns per Video- oder Audiokonferenz via Internet kommunizieren, werden Ihre personenbezogenen Daten von uns und dem Anbieter des jeweiligen Konferenz-Tools erfasst und verarbeitet.
Die Konferenz-Tools erfassen dabei alle Daten, die Sie zur Nutzung der Tools bereitstellen/einsetzen (E-Mail-Adresse und/oder Ihre Telefonnummer). Ferner verarbeiten die Konferenz-Tools die Dauer der Konferenz, Beginn und Ende (Zeit) der Teilnahme an der Konferenz, Anzahl der Teilnehmer und sonstige „Kontextinformationen“ im Zusammenhang mit dem Kommunikationsvorgang (Metadaten).
Des Weiteren verarbeitet der Anbieter des Tools alle technischen Daten, die zur Abwicklung der Online-Kommunikation erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere IP-Adressen, MAC-Adressen, Geräte-IDs, Gerätetyp, Betriebssystemtyp und -version, Client-Version, Kameratyp, Mikrofon oder Lautsprecher sowie die Art der Verbindung.
Sofern innerhalb des Tools Inhalte ausgetauscht, hochgeladen oder in sonstiger Weise bereitgestellt werden, werden diese ebenfalls auf den Servern der Tool-Anbieter gespeichert. Zu solchen Inhalten zählen insbesondere Cloud-Aufzeichnungen, Chat-/ Sofortnachrichten, Voicemails hochgeladene Fotos und Videos, Dateien, Whiteboards und andere Informationen, die während der Nutzung des Dienstes geteilt werden.
Bitte beachten Sie, dass wir nicht vollumfänglich Einfluss auf die Datenverarbeitungsvorgänge der verwendeten Tools haben. Unsere Möglichkeiten richten sich maßgeblich nach der Unternehmenspolitik des jeweiligen Anbieters. Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung durch die Konferenztools entnehmen Sie den Datenschutzerklärungen der jeweils eingesetzten Tools, die wir unter diesem Text aufgeführt haben.
Zweck und Rechtsgrundlagen
Die Konferenz-Tools werden genutzt, um mit angehenden oder bestehenden Vertragspartnern zu kommunizieren oder bestimmte Leistungen gegenüber unseren Kunden anzubieten (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Des Weiteren dient der Einsatz der Tools der allgemeinen Vereinfachung und Beschleunigung der Kommunikation mit uns bzw. unserem Unternehmen (berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Soweit eine Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt der Einsatz der betreffenden Tools auf Grundlage dieser Einwilligung; die Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar.
Speicherdauer
Die unmittelbar von uns über die Video- und Konferenz-Tools erfassten Daten werden von unseren Systemen gelöscht, sobald Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Gespeicherte Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.
Auf die Speicherdauer Ihrer Daten, die von den Betreibern der Konferenz-Tools zu eigenen Zwecken gespeichert werden, haben wir keinen Einfluss. Für Einzelheiten dazu informieren Sie sich bitte direkt bei den Betreibern der Konferenz-Tools.
Eingesetzte Konferenz-Tools
Wir setzen folgende Konferenz-Tools ein:
Zoom
Wir nutzen Zoom. Anbieter dieses Dienstes ist die Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Details zur Datenverarbeitung entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Zoom: https://explore.zoom.us/de/privacy/.
Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://explore.zoom.us/de/privacy/.
Das Unternehmen verfügt über eine Zertifizierung nach dem „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). Der DPF ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, der die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards bei Datenverarbeitungen in den USA gewährleisten soll. Jedes nach dem DPF zertifizierte Unternehmen verpflichtet sich, diese Datenschutzstandards einzuhalten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Anbieter unter folgendem Link: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/5728.
Auftragsverarbeitung
Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) zur Nutzung des oben genannten Dienstes geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.
Unsere Social-Media-Auftritte
Diese Datenschutzerklärung gilt für folgende Social-Media-Auftritte
Datenverarbeitung durch soziale Netzwerke
Wir unterhalten öffentlich zugängliche Profile in sozialen Netzwerken. Die im Einzelnen von uns genutzten sozialen Netzwerke finden Sie weiter unten.
Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter etc. können Ihr Nutzerverhalten in der Regel umfassend analysieren, wenn Sie deren Website oder eine Website mit integrierten Social-Media-Inhalten (z. B. Like-Buttons oder Werbebannern) besuchen. Durch den Besuch unserer Social-Media-Präsenzen werden zahlreiche datenschutzrelevante Verarbeitungsvorgänge ausgelöst. Im Einzelnen:
Wenn Sie in Ihrem Social-Media-Account eingeloggt sind und unsere Social-Media-Präsenz besuchen, kann der Betreiber des Social-Media-Portals diesen Besuch Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Ihre personenbezogenen Daten können unter Umständen aber auch dann erfasst werden, wenn Sie nicht eingeloggt sind oder keinen Account beim jeweiligen Social-Media-Portal besitzen. Diese Datenerfassung erfolgt in diesem Fall beispielsweise über Cookies, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden oder durch Erfassung Ihrer IP-Adresse.
Mit Hilfe der so erfassten Daten können die Betreiber der Social-Media-Portale Nutzerprofile erstellen, in denen Ihre Präferenzen und Interessen hinterlegt sind. Auf diese Weise kann Ihnen interessenbezogene Werbung in- und außerhalb der jeweiligen Social-Media-Präsenz angezeigt werden. Sofern Sie über einen Account beim jeweiligen sozialen Netzwerk verfügen, kann die interessenbezogene Werbung auf allen Geräten angezeigt werden, auf denen Sie eingeloggt sind oder eingeloggt waren.
Bitte beachten Sie außerdem, dass wir nicht alle Verarbeitungsprozesse auf den Social-Media-Portalen nachvollziehen können. Je nach Anbieter können daher ggf. weitere Verarbeitungsvorgänge von den Betreibern der Social-Media-Portale durchgeführt werden. Details hierzu entnehmen Sie den Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Social-Media-Portale.
Rechtsgrundlage
Unsere Social-Media-Auftritte sollen eine möglichst umfassende Präsenz im Internet gewährleisten. Hierbei handelt es sich um ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die von den sozialen Netzwerken initiierten Analyseprozesse beruhen ggf. auf abweichenden Rechtsgrundlagen, die von den Betreibern der sozialen Netzwerke anzugeben sind (z. B. Einwilligung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).
Verantwortlicher und Geltendmachung von Rechten
Wenn Sie einen unserer Social-Media-Auftritte (z. B. Facebook) besuchen, sind wir gemeinsam mit dem Betreiber der Social-Media-Plattform für die bei diesem Besuch ausgelösten Datenverarbeitungsvorgänge verantwortlich. Sie können Ihre Rechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Beschwerde) grundsätzlich sowohl ggü. uns als auch ggü. dem Betreiber des jeweiligen Social-Media-Portals (z. B. ggü. Facebook) geltend machen.
Bitte beachten Sie, dass wir trotz der gemeinsamen Verantwortlichkeit mit den Social-Media-Portal-Betreibern nicht vollumfänglich Einfluss auf die Datenverarbeitungsvorgänge der Social-Media-Portale haben. Unsere Möglichkeiten richten sich maßgeblich nach der Unternehmenspolitik des jeweiligen Anbieters.
Speicherdauer
Die unmittelbar von uns über die Social-Media-Präsenz erfassten Daten werden von unseren Systemen gelöscht, sobald Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Gespeicherte Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen. Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insb. Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.
Auf die Speicherdauer Ihrer Daten, die von den Betreibern der sozialen Netzwerke zu eigenen Zwecken gespeichert werden, haben wir keinen Einfluss. Für Einzelheiten dazu informieren Sie sich bitte direkt bei den Betreibern der sozialen Netzwerke (z. B. in deren Datenschutzerklärung, siehe unten).
Ihre Rechte
Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Ihnen steht außerdem ein Recht auf Widerspruch, auf Datenübertragbarkeit und ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Ferner können Sie die Berichtigung, Sperrung, Löschung und unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Soziale Netzwerke im Einzelnen
Facebook
Wir verfügen über ein Profil bei Facebook. Anbieter dieses Dienstes ist die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (nachfolgend Meta). Die erfassten Daten werden nach Aussage von Meta auch in die USA und in andere Drittländer übertragen.
Wir haben mit Meta eine Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung (Controller Addendum) geschlossen. In dieser Vereinbarung wird festgelegt, für welche Datenverarbeitungsvorgänge wir bzw. Meta verantwortlich ist, wenn Sie unsere Facebook-Page besuchen. Diese Vereinbarung können Sie unter folgendem Link einsehen: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Sie können Ihre Werbeeinstellungen selbstständig in Ihrem Nutzer-Account anpassen. Klicken Sie hierzu auf folgenden Link und loggen Sie sich ein: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Details entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Twitter
Wir nutzen den Kurznachrichtendienst Twitter. Anbieter ist die Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.
Sie können Ihre Twitter-Datenschutzeinstellungen selbstständig in Ihrem Nutzer-Account anpassen. Klicken Sie hierzu auf folgenden Link und loggen Sie sich ein: https://twitter.com/personalization.
Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.
Details entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Twitter: https://twitter.com/de/privacy.