Login für Autoren
Interner Bereich für Autoren.
Bitte nicht vergessen, wieder abzumelden !
Interner Bereich für Autoren.
Bitte nicht vergessen, wieder abzumelden !
Die Lungentransplantation ist im Vergleich zur Nieren-, Herz- und Lebertransplantation ein junges Fachgebiet. Die erste Lungentransplantation führte Prof. J. Hardy im Jahre1963 in den USA durch, aber erst nach Einführung neuer Medikamente gegen die Organabstoßung Ende der 80er Jahre fand die Methode größere Verbreitung. Weltweit unterzogen sich bisher über 14.000 Menschen einer Lungentransplantation, in Deutschland werden jährlich ca. 250 Lungen verpflanzt. Diese Zahl steigt stetig an, da auch der Bedarf ständig wächst.
Lungenkrankheiten unterschiedlichster Art und Ursache können zu einem Organversagen führen, dass medikamentös nicht zu beeinflussen ist. Die häufigsten Krankheiten, die zu einem chronischem Lungenversagen führen können, sind das Lungenemphysem, die Lungenfibrose, die Mukoviszidose und die primär pulmonale Hypertonie. Die Vorgänge im Organismus sind im fortgeschrittenem Stadium einer Lungenkrankheit gleich: Die Lunge kann dem Körper nicht mehr genug Sauerstoff zur Verfügung stellen. Anfangs versucht der Organismus, das Defizit durch verstärkte Atemarbeit und Erhöhung der Herzschlagfrequenz auszugleichen. Wenn diese Mechanismen nicht ausreichen, kommt es zu schwerer Luftnot bereits bei geringster körperlicher Belastung, Blausucht und Wassereinlagerung in den Beinen. Entlastend wirkt die Sauerstoffgabe über eine Nasensonde oder eine Maskenbeatmung. Diese Maßnahmen vermögen jedoch nicht, die fehlende Lungenfunktion völlig zu ersetzen. Der Arzt misst das zunehmende Lungenversagen im Blutgastest: Der Sauerstoffdruck und die Sauerstoffsättigung sinken, das „Abgas“ CO2 steigt an. Diese Situation ist potentiell lebensbedrohlich und kann nur mittels Ersatz der zerstörten Lunge durch ein gesundes Organ abgewendet werden.
Die Entscheidung für einen Organersatz fußt auf folgenden Überlegungen.
1. Es liegt ein chronisches Lungenversagen vor, das mit konservativen medizinischen Maßnahmen nicht abzuwenden ist.
2. Es bestehen keine anderen schwereren Krankheiten, die Lebenszeit oder Lebensqualität begrenzen.
3. Der Patient ist jung und kräftig genug, die schwere Operation durchzustehen.
4. Der Patient ist psychisch stabil und findet hinreichend Unterstützung in seinem sozialen Umfeld
International besteht Konsens, dass Patienten mit einem nicht geheilten Tumorleiden oder HIV keine Kandidaten für eine Transplantation sind. Die Altersgrenze liegt bei ca. 60 Jahren. Patienten mit chronischer Hepatitis B, schwerer Osteoporose, Diabetes mellitus, schwerer Arteriosklerose, floriden Infektionen oder Nervenkrankheiten sind für einen Organersatz weniger geeignet. Die Entscheidung über die Indikation zur Lungentransplantation ist immer individuell und wird am Transplantationszentrum gemeinsam von Lungenärzten, Chirurgen und Psychologen beraten. Voraussetzung ist eine genaue und umfassende Untersuchung, die unter anderem CT der Lunge, Lungenfunktion, 6-Minuten-Gehtest, Spiroergometrie, Bluttest hinsichtlich aller Organfunktionen und auf verschiedene Erreger, Herzkatheter, Ultraschalluntersuchungen der Bauchraumes und der Gefäße, Tumorausschluss durch Gynäkologen bzw. Urologen, Zahnsanierung einschließt.
Fällt die Entscheidung zugunsten der Lungentransplantation, wird der Patient bei der Europäischen Datenbank Eurotransplant in Leiden angemeldet. Dort laufen alle Daten der Organspender und Empfänger zusammen, so dass ein optimal passendes Organ ausgewählt werden kann. Passend heißt: Blutgruppengleich, passende Größe und passendes Alter. Vom Tage der Akzeptanzbestätigung aus Leiden sollte der Patient jederzeit erreichbar sein, denn im Falle eines Organangebotes besteht nur ein kurzes Zeitfenster von wenigen Stunden. Die durchschnittliche Wartezeit auf ein Organ beträgt derzeit etwa 2 Jahre. Verschlechtert sich der Zustand des Kandidaten zu rasch, kann eine Dringlichkeit nach Prüfung der Unterlagen durch internationale Experten zugestanden werden. In diesem Falle verbleibt der Schwerkranke bis zur Transplantation in der Klinik.
Die Gefahren der Lungentransplantation liegen zum einem in den großen Eingriff selbst, in viel stärkerem Maße jedoch in der Abstoßung der fremden Organs und der hohen Infektionsneigung. Fast 20% der Patienten versterben im ersten Jahr, nach 5 Jahren lebt noch gut die Hälfte der Patienten. Insgesamt werden die Ergebnisse durch wachsende Erfahrung der Zentren und effektivere Medikament jährlich besser. Die Statistik sagt jedoch wenig über den individuellen Erfolg aus. Für die meisten Patienten ermöglicht die Transplantation ein neues Leben mit deutlich verbesserter Lebensqualität. Einige Patienten leben bereits länger als 10 Jahre mit ihrer neuen Lunge.
Prof. Dr. med. Christian Witt
Leiter des Arbeitsbereichs Pneumologie mit Schwerpunkt Lungentransplantation und onkologische Pneumologie an der Charité-Universitätsmedizin Berlin
Zuvor lebte ich fast 10 Jahren mit einer dilatativen Kardiomypathie bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz. Im Alltag funktionierte es ganz gut, aber arbeitsfähig war ich nicht mehr. Dank der täglichen Medikamentendosis, die im wesentlichen aus Betablockern, ACE-Hemmern, Blutverdünnern und Entwässerungstabletten bestand, hielt ich mich durchaus akzeptabel über Wasser. Zudem hatte ich einen implantierten Defibrillator, der mehrfach aktiv wurde und meinen mitunter völlig irren Herzrhythmus zumindest vorübergehend wieder ins Lot brachte. Ich stellte mich aber trotzdem schon regelmäßig im DHZB vor, um zu sehen, ob ich schon ein Transplantationskandidat bin.
Nach einer Transplantation ist den Patienten ein neues Leben geschenkt, aber es bleiben lebenslang Gefahren wie Abstoßungsreaktionen und Infektionen. Eine oft nicht beachtete Gefahr ist eine Osteoporose.
Die Osteoporose ist definiert durch eine niedrige Knochenmasse und einer Verschlechterung der Mikroarchitektur mit der Folge einer vermehrten Knochenbrüchigkeit. Menschen, die an einer Osteoporose leiden, brechen sich Knochen aus geringstem Anlass. Typische Knochenbrüche sind Wirbelkörper-, Hüft- (Oberschenkelhals) und Unterarmfrakturen.
Zu Beginn merken die Patienten selbst nicht, dass ihre Knochen immer brüchiger werden. Im Verlauf drohen folgenschwere Knochenbrüche, chronische Schmerzen, Behinderung, Rundrückenbildung und in schweren Fällen auch Pflegebedürftigkeit.
Ein erfahrener Arzt kann aber die Gefahr frühzeitig erkennen und mit den Patienten gemeinsam rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen.
Wer ist besonders gefährdet?
Wenn eine der nachfolgenden Fragen mit „JA“ beantwortet wird eine Abklärung erfolgen:
Es gibt zahlreiche Erkrankungen und Medikamente die ebenfalls altersunabhängig mit einem stark erhöhten Osteoporose- und Knochenbruchrisiko einhergehen. Organtransplantationen und eine Langzeit – Corticoid (Cortison) Behandlung gehören zu den Hauptrisiken.
Osteoporose richtig erkennen
Die Diagnostik der Osteoporose setzt sich aus einem Mosaikmuster zusammen:
1. Krankheitsvorgeschichte:
Bei einem Arzt-Patienten-Gespräch wird festgestellt, ob Sie zu dem Personenkreis zählen, der besonders häufig von Osteoporose betroffen ist und vielleicht schon typische Rückenschmerzen oder Knochenbrüche aufweisen.
2. Körperliche Untersuchung
Es werden Körpergröße und Körpergewicht gemessen und daraus der Body Mass Index berechnet. Beurteilt werden mögliche Wirbelsäulenverformungen (Rundrücken), lokaler Druck- oder Klopfschmerz über der Wirbelsäule sowie Muskelkraft, Gleichgewichtssinn und Sturzteste.
3. Knochendichtemessung mit DXA
Osteoporose geht mit einer stark erniedrigten Knochendichte einher. Zur Messung der Knochendichte wird die als Standardmethode geltende DXA-Technik empfohlen. Ihre Knochendichte wird an der Lendenwirbelsäule und der Hüfte mit geringen Röntgenstrahlen gemessen. Das Ergebnis wird mit der durchschnittlichen Knochendichte von gesunden jungen Erwachsenen verglichen und mit dem so genannten T-Wert beschrieben.
4. Basislaboruntersuchungen
Blutuntersuchungen klären, ob bei Ihnen andere Erkrankungen vorliegen, die die Entwicklung einer Osteoporose begünstigen.
5. Röntgen der Wirbelsäule
Ziel der Röntgenuntersuchung von Brust- und Lendenwirbelsäule ist der Nachweis von osteoporotischen Wirbelkörperbrüchen und der Differentialdiagnose von Rückenschmerzen.
Geröntgt wird vor allem, wenn Sie
Vermeidung von Osteoporose und Knochenbruch!
1. Muskelkraft und Koordination
Empfehlenswert ist eine regelmäßige körperliche Aktivität mit der Zielsetzung Muskelkraft und Koordination zu fördern. Eine Immobilisierung sollte unbedingt vermieden werden.
2. Stürze
Stolperfallen und andere Sturzrisiken sollten vermieden werden. Hierzu zählen auch eine unkontrollierte Einnahme von Beruhigungs- und Schlafmitteln. Bei erhöhter Sturzneigung, vor allem im höheren Lebensalter schützt das Tragen eines Hüftprotektors.
3. Ernährung und knochengesunde Lebensweise
Calcium und Vitamin D ist als Grundlage jeder Osteoporosebehandlung, aber auch zur Vorbeugung unverzichtbar. Es wird eine Zufuhr von 1200 – 1500 mg Calcium und 400 – 1200 IE Vitamin D täglich empfohlen. Ist die Zufuhr durch die Ernährung oder bei Vitamin D durch zusätzlich regelmäßige Bewegung im Freien (UV-Licht) nicht gewährleistet, ist eine Ergänzungsmedikation empfehlenswert.
Nikotin ist zu vermeiden.
Osteoporose wirksam behandeln
1. Basismaßnahmen
2. Psychosoziale Betreuung
Durch eine psychosoziale Betreuung nach Stürzen und Knochenbrüchen kann der Angst vor weiteren Knochenbrüchen, Schmerzen und Einschränkung der Mobilität entgegen gewirkt werden.
3. Behandlung von Schmerzen
Nach einem Knochenbruch sollte schnellstmöglich eine Mobilisierung erfolgen. Zur Schmerzlinderung stehen folgende Maßnahmen zur Verfügung:
Bei therapieresistenten Schmerzen ist nach inter-disziplinärer Begutachtung eine Vertebro- oder Kyphoplastie (Einbringen von Knochenzement in den gebrochenen Wirbelkörper) zu erwägen.
4. Medikamentöse Therapie
Bei der postmenopausalen Frau ist bei folgenden Medikamenten am besten belegt, dass die Gefahr von Wirbelkörperbrüchen nach einer dreijährigen Behandlung im vergleichbaren Umfang reduziert wird.
Osteoporosetherapeutika der 1. Wahl:
Zur Behandlung der Osteoporose bei Männern sind Alendronat und Risedronat zugelassen.
Therapiedauer
Osteoporose ist eine chronische Erkrankung. Die Therapiedauer sollte deshalb mindestens 3 – 5 Jahre betragen – nach individueller Begutachtung – auch länger.
Dr. med. Jutta Semler
Chefärztin Abt. Stoffwechsel / Osteologie
Immanuel – Krankenhaus GmbH
Berlin – Wannsee
Tagesspiegel vom 26.05.2016
Dieser junger Mann hat von den behandelnden Ärzten erfahren, dass die durchschnittliche Wartezeit für ein Herz zwischen sechs und zwölf Monaten beträgt. Ein Durchschnittswert, denn es ist nicht vorhersehbar, wann der Anruf, dass ein Spenderorgan gefunden ist, tatsächlich kommt.
Beitrag über seine Geschichte ➜
BZ vom 01.03.2016
 Was war der schönste Augenblick in den vergangenen Jahren? „Ein Spenderherz, das mir in der Heiligen Nacht eingepflanzt wurde.“
Was war der schönste Augenblick in den vergangenen Jahren? „Ein Spenderherz, das mir in der Heiligen Nacht eingepflanzt wurde.“
Beitrag über Bernd Pankowski ➜
Laura vom 16.12.2015
Angekommen im neuen Leben: "Ohne Hilfe hätte ich es nicht geschafft"

Bild: istockfoto.com/Liderina
Nach einer erfolgreichen Herztransplantation beginnt der Weg zurück in ein gesundes neues Leben mit dem Aufenthalt in einer Reha Klinik, denn es gibt Besonderheiten, deren Handhabung man erleben muss.
Es besteht einerseits lebenslang die Gefahr der Abstoßungsreaktion, andererseits die Disposition zu Infektionskrankheiten. Beide Komplikationen können durch aufmerksame und verantwortungsvolle ärztliche Kontrolluntersuchungen und Patientenmitarbeit in den meisten Fällen vermieden werden.
Organabstossungsreaktion
Das menschliche Immunsystem erkennt Ihr transplantiertes Organ als etwas Fremdes, und versucht es durch eine Abwehrreaktion zu zerstören (abzustoßen).
Deshalb ist eine lebenslange immunsuppressive Therapie notwendig (z.B. mit Sandimmun optoral (Ciclosporin), Imurek, Certican, Prograf oder Cellcept und Cortison). Die Dosierung und Wirksamkeitskontrolle ist die Aufgabe des Arztes, eigenmächtige Dosisänderungen sind nicht erlaubt, weil sie zu schweren Komplikationen führen könnten.
Die ersten Anzeichen einer dennoch auftretenden Abstoßungsreaktion sollten so früh wie möglich erkannt werden, um sie sofort intensiv zu behandeln. Es ist hilfreich daher regelmäßig ein Tagebuch führen mit Eintragungen für Puls, Blutdruck, Gewicht und Temperatur und Beschwerden wie zunehmende Luftnot oder anhaltendes Druckgefühl im Bauch beachten.
Dieses Tagebuch ist für den Arzt und für sie selbst sehr hilfreich bei der Beurteilung des aktuellen Befindens. Weichen die ermittelten Werte deutlich ab, sollten sie sich unbedingt mit ihrer Transplantationsambulanz in Verbindung setzen.
Zögernd Sie nicht, auch abends oder am Wochenende anzurufen. Manchmal können wenige Stunden entscheidend sein.
Ergeben sich Hinweise auf eine Abstoßungsreaktion, so werden Sie gebeten, sofort in die Transplantationsambulanz zu kommen, notfalls werden Sie auch abgeholt.
Infektionen
Durch die immunsuppressive Therapie besteht eine erhöhte Infektanfälligkeit durch Bakterien, Viren oder Pilze. Besondere Vorsicht, vor allem im ersten Jahr nach der Transplantation ist geboten.
Um eine Erkältungskrankheit zu vermeiden, sollten Sie größere Menschenansammlungen meiden und in der Klinik oder Praxis einen Mundschutz tragen.
Gründliche Mundhygiene verhindert eine durch Keime hervorgerufene Infektion der Mundhöhle. Desinfektion von Wunden an der Haut verhütet eine Ausbreitung des Infektionsherdes. Eine gründliche Nahrungsmittelhygiene verhindert Infektionen des Magen-Darm-Trakts, die mit Durchfall, Erbrechen, Übelkeit und Fieber einhergehen und die Aufnahme der Medikamente stören könnten.
Rauchen sollte vermieden werden. Sie bringen damit Ihre neue Chance in Gefahr!
Weitere, im Langzeitverlauf mögliche Nebenwirkungen der Medikamente, die individuell behandelt werden sollten, sind:
Das rechtzeitige Erkennen ist für ihren Behandlungserfolg entscheidend.
Rehabilitationsziele
Nach der Transplantation haben Sie von den Physiotherapeuten gelernt, dass es eine gewisse Zeit benötigt, die schwache Muskulatur wieder zu stärken. Alle Übungen sollen die Ausdauer, die Muskelkraft und dadurch auch die Reaktionsfähigkeit verbessern.
Eine Besonderheit nach einer Herztransplantation ist das denervierte Herz.
Das Herz ist nicht mehr an das autonome Nervensystem angeschlossen ist und kann nur verzögert reagieren. Es dauert einfach länger bis sich das Herz auf Belastung, aber auch auf die anschließende Ruhe einstellen kann.
Starten Sie darum körperliche Aktivitäten langsam und bauen Sie diese langsam auf, damit Puls und Blutdruck genügend Zeit haben sich an die geforderten Belastungen anzupassen
Sportarten, die kurzzeitig hohe Leistung fordern, wie beispielsweite Sprinten, sind nach einer Herztransplantation nicht empfehlenswert, ansonsten aber kein Problem.
Gehen, Wandern, Gymnastik, Wassergymnastik, Radfahren usw. sind für alle Transplantierten empfehlenswert.
Gesunde Ernährung
Der Gesundungsprozess wird durch eine ausgewogene, gesunde Ernährung unterstützt. Sie sollte kochsalzreduziert, cholesterinarm, fettreduziert und zuckerarm sein und dazu reich an Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen, sowie energetisch und inhaltlich bedarfsgerecht.
Durch die gesunde Ernährung kann man Probleme im Langzeitverlauf wie Bluthochdruck, Gewichtszunahme, Diabetes und Arteriosklerose günstig beeinflussen.
Psychologische Betreuung
Nach einer Transplantation brauchen viele Patienten seelische Unterstützung. Die schwerwiegenden Erfahrungen der Erkrankung bleiben nicht ohne Folgen. Auch die neuen Medikamente, können zu seelischem Ungleichgewicht beitragen, dürfen aber keines falls selbstständig geändert werden.
Um mit den Stimmungsschwankungen, mit Angst und Depression und tiefer Traurigkeit fertig zu werden, ist oft professionelle Hilfe durch einen Psychotherapeuten erforderlich.
Meistens sind diese seelischen Beeinträchtigungen vorübergehender Natur, denn die meisten Patienten erleben einen Zustand der deutlich verbesserten Lebensqualität relativ bald nach der Operation.
Zusammenfassung
In der Rehaklinik lernen Sie, die Medikamente selbstständig und regelmäßig einzunehmen. Hier lernen Sie auch Verantwortung für Ihre Gesundheit zu übernehmen. Sie werden jetzt Fachmann in eigener Sache. Sie bestimmen selbst über Ihr Verhalten und damit über Ihre Zukunft.
Sie wissen, dass Alkohol und Nikotin gesundheitsschädigend wirken, und meiden dies.
Sie wissen, das zu reichliche Ernährung Gewichtsprobleme verursacht, und dass Bewegungsmangel zu Muskel- und Knochenschwäche führt, und machen sich einen entsprechenden Plan.
Selbsthilfe und Patientenvereine
Patientenvereine helfen dabei, sowohl körperlich, als auch seelisch ein Optimum zu erzielen.
Dazu gehört die Wiederaufnahme gewohnter Aktivitäten, auch des Berufes, Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Wiedereingliederung in die Familie und das soziale Umfeld.
Der Austausch mit anderen Transplantierten schafft Stabilität und eine Zukunftsperspektive.
Die Übernahme der Verantwortung für die eigene Gesundheit, Experte werden in eigener Sache und das Erlangen von Kenntnissen über die Besonderheiten einer Transplantation sind für ein langes und gesundes Leben unerläßlich.

Bild: istockfoto.com/Julia_Sudnitskaya
Sowie die ersten Wochen nach einer Transplantation überstanden sind, entsteht der Wunsch wieder eine Reise anzutreten. Reisen mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug sind möglich.
Zunächst werden nahe Ziele ins Auge gefasst, bei denen man auf kurzen Wegen sein Ziel erreicht und weder Klima- noch Zeitunterschiede eine Rolle spielen. Dies wird im Allgemeinen möglich sein und nur wenige organisatorische Fragen sind zu klären:
Die Vorbereitung
Klären Sie zunächst die folgenden Fragen:
Falls Sie für einen längeren Zeitraum verreisen, müssen Sie vorher mit Ihrer Ambulanz die Häufigkeit erforderlicher Blutabnahmen besprechen und gegebenenfalls am Urlaubsort die Adresse eines Labors (beim Arzt oder im Krankenhaus) erfragen. Achten Sie darauf, dass der konsultierte Arzt bereit ist, jederzeit mit Ihrem Zentrum Rücksprache zu halten und zu kooperieren.
In Ihrem Notfallausweis sollten Ihre wichtigsten medizinischen Daten stehen, sowie die Telefonnummern von Transplantationsambulanz und Herzzentrum.
Die Reiseapotheke
Alle Medikamente, die Sie vom Herzzentrum verordnet bekommen haben, sollten Sie in ausreichender Menge mitführen. Ansonsten gehört in die Reiseapotheke:
Sollten Sie trotz aller Vorsicht im Urlaub erkranken, müssen Sie sich mit Ihrem Zentrum in Verbindung setzen, um zu klären, ob Sie den Heimweg antreten sollen, oder ob Sie einen örtlich ansässigen Arzt konsultieren sollen, der mit dem Ihrem Arzt Kontakt aufnimmt und ggf. Ihre Behandlung übernimmt. Wenn Sie zurückkommen müssen, dann ist zu klären, auf welchem schnellstmöglichen Wege das geschehen soll.
Fernreisen
Will man aber eine Fernreise unternehmen, sollte man folgende Aspekte überdenken:
Zunächst besteht das Problem einer langen Rückreise im Notfall, die ungewohnten klimatischen Verhältnisse, z.B. in den Tropen oder der Arktis, die Zeitverschiebung, die hygienischen Verhältnisse, die ungewohnte Kost, verunreinigte Gewässer durch Parasiten, Vorkommen besonderer Infektionskrankheiten, Verständigungsschwierigkeiten durch mangelnde Sprachkenntnisse.
Dazu ergeben sich spezielle Fragen:
Impfungen sollte man jeweils rechtzeitig vor Reiseantritt mit dem Tropeninstitut absprechen, denn je nach Reiseziel sind die Empfehlungen verschieden.
Allgemein gilt, dass nur Impfungen mit so genanntem Totimpfstoff gegen Poliomyelitis, Diphtherie, Tetanus, Pneumokokken, Hepatitis A und B und Influenza erlaubt sind.
Hingegen sind Impfungen mit Lebendimpfstoff, wie z. B. gegen Masern, Mumps und Röteln sowie Gelbfieber nicht erlaubt.
Deswegen bestehen Reisebeschränkungen für Länder mit Gelbfiebergefahr.
Vorsichtsmaßnahmen
Reisekrankheiten durch mangelhafte Hygiene der Nahrungsmittel oder des Trinkwassers erfordern gewisse Einschränkungen. Meiden Sie rohes Fleisch oder Fisch, Eierspeisen, Leitungswasser, Eiswürfel, Speiseeis, Getränke aus offenen Flaschen, Salate.
Es gilt die Regel der WHO als Grundsatz für die Ernährung in tropischen und subtropischen Ländern: "peel it, boil it, cook it or forget it!" ("schälen, kochen, braten oder verzichten“)
Insektenschutz
Malaria wird durch den Stich einer Mücke übertragen.
In tropischen Ländern, in denen die Mücke verbreitet ist, muss man sich intensiv schützen. Dazu gehören ein Moskitonetz, Repellentien zum Einreiben der Haut, Schutz durch zweckmäßige Kleidung und Malariamittel, die entsprechend des Reisezieles vom Tropeninstitut zu erfragen sind.
Sonnenschutz für die Haut nicht vergessen. (bitte beachten Sie auch unsere Broschüre zum Thema Hautschutz nach der Transplantation)
Barfuss laufen oder Baden in Gewässern (außer dem Meer) meiden.
Sexuelle Kontakte natürlich nur mit Schutz.
Treffpunkte für Patienten und Mitglieder

Deutsches Herzzentrum Berlin
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Tel: 030 / 45 93 10 00
IOP Café- Erfahrungsaustausch bei Kaffee und Kuchen:
Jeden letzten Donnerstag im Monat von 14:00 - 16:00 Uhr in der Bibliothek des Deutschen Herzzentrums Berlin.
„Neues Organ - was nun"
Unsere Transplantationsbegleiter der IOP besuchen regelmäßig die Station H3 um mit anderen Patienten zu sprechen und sie in der ersten Zeit nach der Transplantation zu unterstützen.
Ort: Station H3, DHZB, 14-tägig jeweils Dienstags ab 15 Uhr
Aktuelle Termine finden Sie hier ➜

Paulinenhaus Krankenanstalt e.V.
Dickensweg 25-39
14055 Berlin
Tel: 030 / 3 00 08-0
Jeden letzten Dienstag im Monat um 15.00 Uhr steht Ihnen im Aufenthaltsraum der Station P2 ein Gesprächspartner von uns zur Verfügung.
Aktuelle Termine finden Sie hier ➜

Rehabilitationsklinik Seehof der Deutschen Rentenversicherung Bund Lichterfelder Allee 55
14513 Teltow/Berlin
Tel: 03328 / 345-0
Jeden letzten Dienstag im Monat um 15.00 Uhr steht Ihnen im Aufenthaltsraum der Station P2 ein Gesprächspartner von uns zur Verfügung.
Inforunde zum Leben nach der Transplantation: Jeden zweiten Mittwoch im Monat von 15:00 - 16:30 Uhr.
Aktuelle Termine finden Sie hier ➜

1. Vorsitzende transplantiert e.V.
Email:

stellvertretende Vorsitzende transplantiert e.V.
Email:

Kassenwart
Email:
Beisitzerin
Email:

Hat man sich zu einer Transplantation durchgerungen, kommt man als erstes einmal auf die Warteliste. Ab hier heißt es, Geduld haben und durchhalten. Wie lange die Wartezeit ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Schwergrad der Erkrankung, oder auch der Blutgruppe. Ebenfalls ist die Verfügbarkeit der Organe ein wichtiger Faktor. Laut aktuellen Zahlen bekommt derzeit rund die Hälfte aller Wartepatienten ein Organ, während die andere Hälfte die Wartezeit nicht überlebt. Schuld daran ist der Mangel an Spenderorganen.
Patienten, denen es gesundheitlich noch möglich ist, verbringen diese Wartezeit zu Hause. Andere sind bereits so krank, dass sie in der Klinik warten. Wichtig ist, dass man in ständigem Kontakt mit seinem Arzt und der Klinik steht, und dass man immer erreichbar ist. Dazu bekommt der Patient eine Handy oder einen Europieper. So ist gewährleistet, dass man innerhalb kürzester Zeit in der Klinik sein kann.
Verschlechtert sich der Gesundheitszustand, wird man von der normalen Warteliste auf eine Dringlichkeitsstufe gelistet. Patienten, die auf dieser HU (High Urgency) Liste stehen, müssen sich in dem anmeldenden Transplantationszentrum in stationärer Behandlung befinden. Die Einstufung in die Dringlichkeitsstufe HU trifft der medizinische Dienst der Vermittlungsstelle.
Die Wartezeit für ein Herz beträgt laut der Stiftung "Eurotransplant" derzeit im Schnitt acht bis zehn Monate. Immerhin werden in Deutschland jährlich 400 Herzen transplantiert. Und die Wartezeit für Herz und Lunge zusammen beträgt im Schnitt zwei Jahre. Manchmal ist es so, dass andere Patienten, die weniger lang warten, früher transplantiert werden. Das liegt dann daran, dass das Organ dort besser gepasst hat. Durch die sorgfältige Auswahl wird das Komplikationsrisiko niedriger.
Die Wartezeit ist für alle eine schwierige Zeit. Herausgerissen aus dem Alltag, mit einer ungewissen Zukunft, haben viele Patienten Probleme mit dem täglichen Durchhalten. Dazu kommt die Angst, wie es wohl sein wird, mit einem fremden Organ aufzuwachen. Fragen, warum erst jemand sterben muss, damit man selbst weiterleben kann, etc. beschäftigen die Patienten, wenn sie nichts tun können, als warten.
Hier sind Gespräche oft hilfreich. Sowohl Psychologen, als auch bereits Transplantierte können dem Patienten, und den Angehörigen eine große Hilfe sein. Trauen Sie sich, ihre Fragen zu stellen. Wir helfen gerne weiter.
Informationen zu Organspende und Transplantation
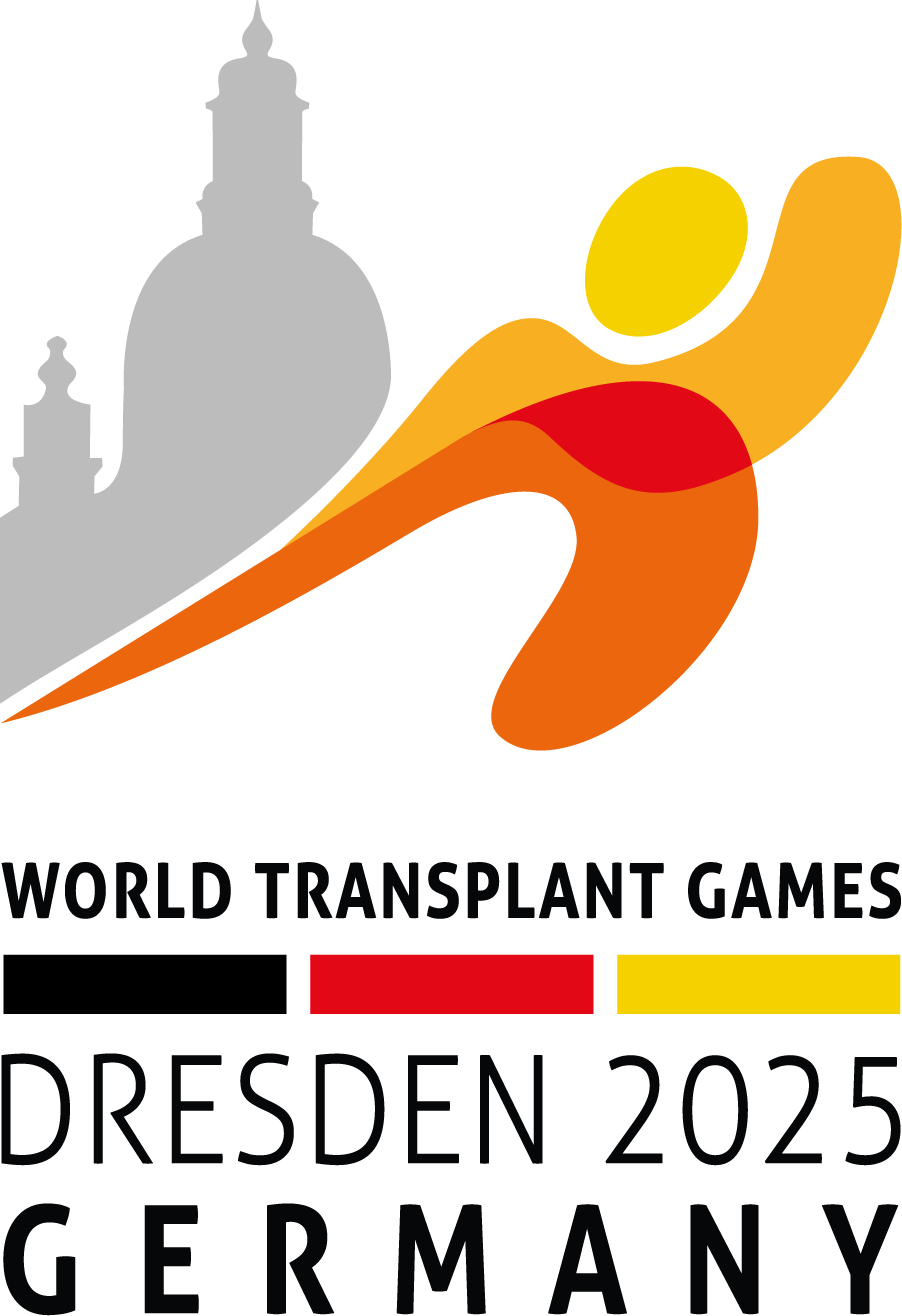
World Transplant Games 2025 Dresden

Bundeszentrale für geundheitliche Aufklärung - BZgA

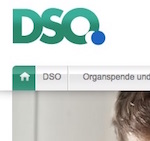
Deutsche Stiftung Organtransplantation

Transplantation verstehen (Novartis)


Verein für Herz-Lungen-Transplantation Leipzig e.V.

Herztransplantation Südwest e.V.


TransDia Sport Deutschland e.V.
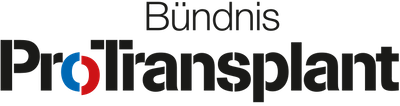

Lebertransplantierte Deutschland e.V.


Foto: ©MaxThrelfallPhoto
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern des Wiederleben Fotoshootings für ihre Teilnahme und das tolle Engagement bei Foto und Filmaufnahmen. Alle hatten viel Spaß, aber es gab auch sehr emotionale Momente.
Aus den Fotos entstand unsere Ausstellung Wiederleben, die Sie unter www.wiederleben-ausstellung.de.de ansehen können.